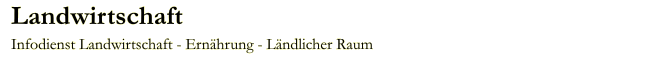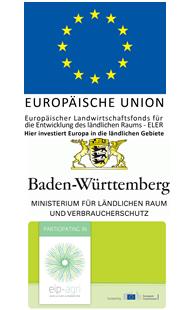Unter Effizienz wird im Allgemeinen das Verhältnis zwischen Input und Output verstanden. Dieses Verhältnis soll so ausgewogen sein, dass den landwirtschaftlichen Betrieben mit ihrer Struktur und der Arbeitsbelastung, der Umwelt und der Ökonomie, Rechnung getragen wird. Bereits aus vielen Veröffentlichungen bekannt ist zum Beispiel die Futtereffizienz, die die Futterverwertung mit der aufgenommenen Menge und den Kosten an Futter ins Verhältnis setzt.
Bei KlimaFit soll nun die Effizienz der Tiere in verschiedenen Lebensabschnitten vom Kalb bis zur Kuh und unter verschiedenen Haltungsbedingungen bestimmt werden, um so eine Aussage über die Lebenseffizienz fällen zu können. Lebenseffizienz ist ein neues Merkmal, das am Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg entwickelt wird. Durch Züchtung auf Lebenseffizienz im Sinne einer ressourcen- und klimafreundlichen Milch- und Rindfleischerzeugung soll ein verbesserter Output erreicht werden. Insbesondere in den Bereichen:
- Fitness, inklusive Gesundheit und Tierwohl
- Futterverwertung
- Positive Umweltleistungen und verringerter Ressourcenverbrauch durch Verwertung von Grünlandfutter
Dabei wird der gesamte Lebenszyklus des Tieres betrachtet. Unter Input ist hier auf den landwirtschaftlichen Betrieben unter anderem die Rasse, beziehungsweise das Einzeltier mit seiner genetischen Ausstattung, sowie die Haltungsumwelt, das sind zum Beispiel Fütterung und Herdenmanagement, zu verstehen. Der Output setzt sich zum Beispiel aus tierischen Produkten, Fitness, Gesundheit, Tierwohl, Nutzungsdauer, Futterverwertung, Umweltleistung und Ressourcenverbrauch zusammen.
Die Abbildung zeigt beispielhaft die verschiedenen Input- und Outputfaktoren der Lebenseffizienz.